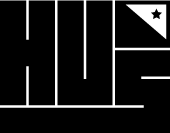Gemeinsam mit der FIPU haben wir eine Veranstaltungsreihe organisiert. In 5 Terminen wollen wir verschieden Aspekte der im Titel der Reihe genannten Thematik beleuchten. Die ersten 4 Termine finden immer im HS II im Erdgeschoss des NIG (Universitätsstraße 7) statt, der 5. Termin ist ein Rundgang, zu dem wir uns im Arkadenhof des Hauptgebäudes treffen (außer es regnet, dann in der Aula des selbigen). Kommt zahlreich und spread the word!
Es gibt auch ein Fb-Event: https://www.facebook.com/events/195290441062675/
10. April 2018, 19:00
Andreas Peham (Vortrag, Führung, Diskussion): Die Universität Wien als Wiege des Nazismus. Zur Bedeutung der Burschenschaften für den inneren „Anschluss“. Teil I
Daniel J. Goldhagens Diktum „Keine Deutschen, kein Holocaust“ ist zu präzisieren: „Keine (ostmärkischen) Burschenschafter, kein Holocaust“. Die deutsch-völkischen Korporierten bildeten hierzulande mehr noch als in Deutschland die Avantgarde des rassistischen Erlösungsantisemitismus. Seit den 1890er Jahren versuchten sie, ihre deutschen Waffenbrüder auf Arierparagraph und Judenreinheit zu verpflichten – leider mit Erfolg. Nach 1918 verstärkten sie ihre antisemitische Wühlarbeit auch an den Universitäten, welche sie unter dem Mantel der „Freiheit“ und „Autonomie“ weitgehend gewähren ließen. Und so wurden sie zum maßgeblichen Ort der ideologischen wie personellen Vorbereitung des Nazismus und der Shoah.
Nach einer Einführung soll das Thema bei einem Rundgang durch die Universität vertieft werden.
17. April 2018, 18:30
Klub Zwei (Simone Bader & Jo Schmeiser): Things. Places. Years (2004)
Die filmische Dokumentation Things. Places. Years. versammelt Interviews mit jüdischen Frauen, die als Kinder oder Jugendliche aus dem nationalsozialistischen Wien nach London flüchten konnten. Im Film zu Wort kommen auch ihre Töchter und Enkeltöchter. Zentrales Thema ist die Erfahrung von Vertreibung, Emigration und Holocaust. Es soll gezeigt werden, dass diese Erfahrung von Generation zu Generation weitergegeben wird und wie sie im Leben junger jüdischer Frauen – bis heute – nachwirkt.
Filmscreening, im Anschluss Diskussion mit Jo Schmeiser
19. April 2018, 19:00
Margit Reiter (Vortrag/Diskussion): Der Nationalsozialismus im Familiengedächtnis
Der Nationalsozialismus ist hierzulande Teil jeder Familiengeschichte. Die Zeithistorikerin Margit Reiter untersuchte, wie der Nationalsozialismus in Nachkriegsfamilien, die keine Nazi-Opfer zu beklagen hatten, erinnert und an die nachfolgende Generation weiter gegeben wurde. In den Familien wurde keineswegs nur geschwiegen. Was aber wurde erzählt, wie wurde darüber gesprochen – und was wurde ausgeblendet und tabuisiert? Das Familiengedächtnis und der öffentliche NS-Diskurs haben die Vorstellungswelt der zweiten Generation nachhaltig geprägt. Was wissen die Nachkommen eigentlich über ihre Väter und Mütter im Nationalsozialismus, wie gehen sie heute mit deren (potenzieller) Täterschaft um? Die Autorin hat „Kinder der Täter“ interviewt und die vielfältigen Formen des Umgangs mit dem familiären NS-Erbe – von kritischer Distanzierung über Verständnis bis hin zu reflexartiger Verteidigung – aufgezeigt und analysiert.
24. April 2018, 19:00
Elke Rajal (Vortrag/Diskussion): Holocaust-Education und antisemitismuskritische Bildungsarbeit. Bestandsaufnahme, Kritik und Anforderungen
Ausgehend von den zahllosen politischen Bekenntnissen zu zeitgeschichtlichem Unterricht wird analysiert, wie es um eine „Erziehung nach Auschwitz“ in Österreich heute bestellt ist. Nach einer Kritik an einer Auswahl von entsprechenden Bildungsangeboten werden die Anforderungen an eine reflexive Form der Holocaust Education gesammelt, wobei die strukturellen und persönlichen Hemmnisse nicht aus dem Blick geraten. Angesichts der nur beschränkten Wirkung eines – auch noch so guten – zeitgeschichtlichen Unterrichts zur Prävention von Antisemitismus wird dann für die Notwendigkeit antisemitismuskritischer Bildungsanstrengungen argumentiert. Abschließend sollen deren Grundlagen und Formen – auch und besonders in der Migrationsgesellschaft – diskutiert werden.
9. Mai 2018, 17:30
N.N. (FIPU): Zur Bedeutung der Burschenschaften für den inneren „Anschluss“. Teil II: Antikorporierter Stadtspaziergang zur Geschichte und Gegenwart deutschvölkischer Verbindungen in Wien